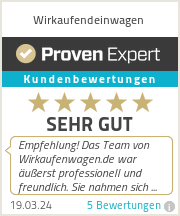Die Zukunft des Verbrenners: Zwischen Oldtimer-Boom, Elektro-Umbauten und globaler Nachfrage

Seit über 130 Jahren prägt der Verbrennungsmotor die Geschichte des Automobils – vom knatternden Einzylinder über legendäre V8-Maschinen bis hin zu modernen Downsizing-Triebwerken mit Turbolader. Doch angesichts der Elektromobilität, des Klimawandels und verschärfter Emissionsvorschriften scheint seine Ära ihrem Ende entgegenzugehen.
Doch ist der Verbrenner wirklich am Ende? Oder steht ihm lediglich ein Wandel bevor, der ihn in neuer Form weiterleben lässt?
In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Zukunft des Verbrennungsmotors – von der Renaissance der Oldtimer-Kultur, über Retrofits, also den Umbau alter Fahrzeuge auf Elektroantrieb, bis hin zur anhaltend hohen Nachfrage nach Benzin und Diesel in Schwellen- und Entwicklungsländern.
1. Der Status quo: Das Ende des Verbrenners in Europa?
Der politische Druck wächst
In Europa haben sich Politik und Industrie längst auf einen klaren Kurs geeinigt: Ab 2035 sollen keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden – zumindest, wenn sie nicht mit sogenannten E-Fuels betrieben werden. Dieses Ziel, festgelegt durch die EU, soll den Straßenverkehr klimaneutral machen.
Hersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder Ford investieren Milliarden in Elektromobilität und Batterieentwicklung. Gleichzeitig verschwinden klassische Verbrenner-Modelle zunehmend aus den Konfiguratoren.
Doch während die Zukunft des Neuwagenmarkts klar elektrisch scheint, ist die Realität auf den Straßen eine andere: Noch immer rollen über 40 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor allein in Deutschland. Und viele davon werden nicht so schnell verschwinden – im Gegenteil.
2. Der Oldtimer-Boom: Leidenschaft statt Leistung
Die Liebe zum Verbrenner lebt weiter
Oldtimer sind längst mehr als nur alte Autos – sie sind Kulturgut, Investition und emotionale Zeitkapsel. Der Klang eines Porsche 911 aus den 1970er-Jahren, der Geruch von unverbranntem Benzin oder das Gefühl, eine Maschine rein mechanisch zu beherrschen – all das lässt sich durch kein Elektroauto ersetzen.
Diese Leidenschaft spiegelt sich in Zahlen wider: Laut Kraftfahrt-Bundesamt ist die Zahl der zugelassenen Oldtimer mit H-Kennzeichen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Im Jahr 2024 waren es bereits über 900.000 Fahrzeuge – Tendenz steigend. Clubs, Messen und spezialisierte Werkstätten erleben einen regelrechten Aufschwung.
Sammler sichern die Verbrenner-Kultur
Viele Sammler betrachten ihre Fahrzeuge nicht nur als Hobby, sondern als kulturelle Mission. Sie bewahren Technikgeschichte – von frühen Reihenmotoren bis hin zu großvolumigen V12-Triebwerken. Marken wie Ferrari, Aston Martin, Mercedes-Benz oder BMW pflegen ihre Tradition gezielt, indem sie Classic-Abteilungen betreiben, Ersatzteile nachproduzieren und historische Modelle restaurieren.
Oldtimer gelten außerdem als Wertanlage. Während Elektroautos rapide an Wert verlieren können, steigen gut gepflegte Verbrenner-Ikonen im Preis. Besonders seltene Modelle erzielen bei Auktionen Höchstpreise. So wurde etwa ein Ferrari 250 GTO für über 40 Millionen Euro versteigert – ein Symbol für die emotionale und finanzielle Bindung an klassische Antriebe.
Nachhaltigkeit durch Erhalt statt Verschrottung
Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: Alte Autos weiterzufahren kann nachhaltiger sein, als neue zu produzieren. Zwar stoßen sie mehr CO₂ pro Kilometer aus, doch die Emissionen, die bei der Herstellung eines Neuwagens entstehen, entfallen. Viele Oldtimer-Besitzer fahren ihre Fahrzeuge nur selten – das relativiert den ökologischen Fußabdruck deutlich.
So entsteht ein spannendes Paradox: Ausgerechnet die Liebhaber alter Verbrenner tragen indirekt zur Ressourcenschonung bei.
3. „Retrofits“: Alte Verbrenner werden elektrisch

Vom Knattern zum Surren – die neue Form der Fahrzeugkultur
Ein Trend, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, ist der Umbau klassischer Fahrzeuge auf Elektroantrieb – sogenannte Retrofits. Hierbei wird der ursprüngliche Verbrennungsmotor entfernt und durch einen Elektromotor samt Batterie ersetzt. Das Ergebnis: ein Oldtimer mit emissionsfreiem Antrieb, aber dem Charme vergangener Zeiten.
Unternehmen wie Everrati, Lunaz oder Electrogenic in Großbritannien haben sich auf diesen Markt spezialisiert. Sie elektrifizieren Klassiker wie den Jaguar E-Type, den Porsche 911 oder den Land Rover Defender. Auch in Deutschland wächst die Szene – immer mehr kleine Werkstätten bieten entsprechende Umbauten an.
Technik trifft Emotion
Retrofits sind eine faszinierende Symbiose aus Tradition und Zukunft: Die Karosserie bleibt original, der Antrieb wird modernisiert. Dadurch behalten die Fahrzeuge ihren historischen Charakter, erfüllen aber gleichzeitig aktuelle Umweltstandards.
Viele dieser Umbauten sind reversibel – der Originalmotor kann auf Wunsch wieder eingebaut werden. So bleibt das Fahrzeug auch aus Sammlersicht interessant.
Natürlich ist ein Retrofit kein günstiges Unterfangen: Je nach Modell können die Kosten zwischen 20.000 und 100.000 Euro liegen. Doch für viele Enthusiasten ist es die perfekte Lösung, um ihren geliebten Klassiker auch in Zukunft auf öffentlichen Straßen bewegen zu dürfen.
Gesetzliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Noch ist der Retrofit-Markt rechtlich ein Graubereich. In Deutschland müssen Umbauten vom TÜV oder einer anerkannten Prüforganisation abgenommen werden, was Zeit und Geld kostet. Doch der Gesetzgeber zeigt sich zunehmend offen. Frankreich und Italien etwa fördern bereits den Umbau alter Fahrzeuge auf Elektro, um die Emissionen in Innenstädten zu reduzieren.
Auch Automobilhersteller erkennen das Potenzial: Stellantis (der Mutterkonzern von Peugeot, Citroën und Fiat) testet bereits eigene Retrofit-Kits für ältere Modelle. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten Retrofits in den kommenden Jahren zu einem echten Massenphänomen werden.
4. Die globale Perspektive: Warum der Verbrenner weltweit weiterlebt
Entwicklungsländer bleiben auf Verbrenner angewiesen
Während Europa den Verbrennungsmotor verabschiedet, bleibt er in vielen Teilen der Welt unverzichtbar. In Afrika, Südamerika und Teilen Asiens ist die Elektromobilität noch weit von der Alltagstauglichkeit entfernt. Gründe dafür sind vielfältig: fehlende Ladeinfrastruktur, instabile Stromnetze, hohe Fahrzeugpreise und begrenzte politische Unterstützung.
In Ländern wie Nigeria, Indien oder Indonesien ist der Verbrenner daher weiterhin das Rückgrat der individuellen Mobilität. Hier zählt vor allem Robustheit, einfache Reparatur und Verfügbarkeit von Ersatzteilen – Punkte, in denen moderne Elektroautos oft unterlegen sind.
Der Gebrauchtwagenexport als Lebensader
Ein weiterer Faktor, der den Verbrenner am Leben hält, ist der internationale Fahrzeugexport. Millionen Gebrauchtwagen aus Europa werden jährlich in andere Länder verkauft – viele davon nach Osteuropa, Afrika oder den Nahen Osten.
Diese Fahrzeuge, oft mit hoher Laufleistung oder ohne gültigen TÜV, finden dort ein zweites Leben. Werkstätten vor Ort können sie günstig reparieren, und Kraftstoffe sind vielerorts deutlich günstiger als Strom.
So entsteht ein globaler Kreislauf: Was in Europa als „veraltet“ gilt, ist andernorts ein wertvolles Transportmittel. Diese Entwicklung verlängert die Lebensdauer des Verbrenners weltweit um Jahrzehnte.
Industrie und Politik im Spannungsfeld
Auch auf geopolitischer Ebene bleibt der Verbrenner relevant. Öl-Exporteure wie Saudi-Arabien, Russland oder Venezuela haben ein starkes Interesse daran, den Absatz fossiler Brennstoffe zu sichern. Gleichzeitig investieren viele dieser Länder selbst in synthetische Kraftstoffe, um den Wandel nicht völlig zu verschlafen.
China wiederum setzt zwar massiv auf Elektromobilität, produziert aber weiterhin Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor für Exportmärkte in Afrika und Südostasien. Der globale Fahrzeugmarkt wird also noch lange dual bleiben – elektrisch im Westen, fossil im Rest der Welt.
5. Die Rolle synthetischer Kraftstoffe (E-Fuels)
Hoffnungsträger für den klimaneutralen Verbrenner
Ein zentraler Punkt in der Debatte um die Zukunft des Verbrenners sind synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt. Diese werden aus Wasserstoff und CO₂ hergestellt und können theoretisch klimaneutral sein, wenn sie mit erneuerbarer Energie produziert werden.
Mehrere Unternehmen – darunter Porsche, Siemens Energy und HIF Global – arbeiten an Pilotanlagen, die E-Fuels in industriellem Maßstab herstellen. Diese könnten den Bestand an Verbrennerfahrzeugen langfristig klimafreundlicher machen, ohne dass Motoren oder Infrastruktur komplett ersetzt werden müssen.
Die Realität: Noch zu teuer, aber mit Potenzial
Aktuell liegen die Produktionskosten für E-Fuels noch bei über 4 Euro pro Liter, was sie für den Massenmarkt unattraktiv macht. Doch wie bei jeder neuen Technologie sinken die Preise mit wachsender Skalierung.
Sollte es gelingen, E-Fuels kosteneffizient herzustellen, könnten Millionen bestehender Fahrzeuge weiterhin betrieben werden – ohne fossiles CO₂ zusätzlich in die Atmosphäre zu bringen.
6. Der emotionale Faktor: Warum der Verbrenner bleibt
Mehr als nur Technik
Für viele Autofans ist der Verbrennungsmotor mehr als ein Antrieb – er ist ein Stück Identität. Das Gefühl, einen Motor zu hören, zu riechen und zu beherrschen, ist tief in der automobilen Kultur verwurzelt.
Sound, Schaltvorgang, Drehmomentverlauf – all das erzeugt Emotionen, die Elektroautos oft nicht reproduzieren können.
Diese emotionale Bindung sorgt dafür, dass der Verbrenner in bestimmten Nischen – etwa bei Sportwagen, Motorrädern oder Oldtimern – erhalten bleibt. Hersteller wie Lamborghini, Ferrari oder BMW M entwickeln weiterhin Hochleistungs-Verbrenner, oft kombiniert mit Hybridtechnik oder E-Fuels, um den Übergang in eine CO₂-ärmere Zukunft zu schaffen.
7. Zwischenfazit: Der Verbrenner ist nicht tot – er wandelt sich

Der Verbrennungsmotor wird zwar aus den Neuwagenmärkten Europas verschwinden, doch global betrachtet bleibt er ein fester Bestandteil der Mobilität. Seine Zukunft liegt nicht im Massenmarkt, sondern in Nischen, Innovationen und Regionen, die andere Bedürfnisse haben.
• In Europa überlebt er als Hobby und Kulturgut.
• Technologisch lebt er durch Retrofits und E-Fuels weiter.
• Global bleibt er für Millionen Menschen unverzichtbar.
Der Verbrenner wird also nicht sterben – er wird sich transformieren.
8. Ausblick: Wie die Zukunft wirklich aussehen könnte
2035 – das Jahr der Wende?
Wenn das EU-Verbrennerverbot 2035 tatsächlich in Kraft tritt, wird der Straßenverkehr in Europa deutlich elektrischer aussehen. Doch die Bestandsflotte an Verbrennern wird noch Jahrzehnte unterwegs sein. Experten gehen davon aus, dass erst 2050 oder später die Mehrheit der Fahrzeuge weltweit elektrisch fährt.
Bis dahin wird der Verbrenner neue Rollen finden: als Sammlerobjekt, als umgebauter Klassiker oder als Nutzfahrzeug in Regionen ohne Infrastruktur. Gleichzeitig werden neue Technologien wie E-Fuels oder Hybridantriebe die Brücke schlagen.
Eine neue Ära der Vielfalt
Die Zukunft der Mobilität wird nicht nur elektrisch sein – sie wird vielfältig. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, Hybridlösungen und Retrofits sorgen für eine breite technologische Landschaft.
Der Verbrenner wird dabei zum Symbol einer vergangenen, aber nicht vergessenen Epoche – ähnlich wie Dampflokomotiven heute in Museen und Sonderfahrten weiterleben.
Fazit: Der Verbrenner bleibt – nur anders
Die Zukunft des Verbrennungsmotors ist kein abruptes Ende, sondern ein langsamer, vielgestaltiger Übergang. Während Politik und Industrie auf Elektromobilität setzen, findet der Verbrenner neue Wege, relevant zu bleiben:
• Oldtimer-Boom: Liebhaber und Sammler bewahren Technikgeschichte und schaffen emotionale Verbindungen.
• Retrofits: Alte Fahrzeuge werden zu modernen Elektroautos umgebaut – ein Kompromiss zwischen Vergangenheit und Zukunft.
• Globale Nachfrage: In vielen Regionen der Welt bleibt der Verbrenner wirtschaftlich und praktisch unersetzlich.
So wird der Motor, der das 20. Jahrhundert geprägt hat, auch im 21. nicht vollständig verschwinden. Er wird sich anpassen – leiser, sauberer, seltener – aber immer mit einem unverwechselbaren Herzschlag, der für viele Menschen mehr bedeutet als nur Fortbewegung.